3.1.2.2 Bestand
Im Planungsgebiet wurden knapp 200 verschiedene Biotoptypen erfasst, deren wichtigsten Ausprägungen nachfolgend im Zusammenhang beschrieben werden (siehe auch Tabelle A 3.1-2). In übereinstimmung mit dem Leitfaden (Paterak et al. 2001), werden lediglich besonders hochwertige Biotope[1] bzw. gebietsspezifische Besonderheiten hervorgehoben. Zur floristischen Zusammensetzung und vegetationskundlichen Einordnung der Biotoptypen sei auf den Kartierschlüssel von Drachenfels (1994) verwiesen.
Auf einer höheren Aggregationsstufe gibt Abbildung 3.1-1 einen überblick über die Verteilung der Biotoptypen im Gesamtraum sowie in den verschiedenen Naturräumen (detaillierte Prozentzahlen dazu siehe Tabelle A 3.1-1 im Anhang)[2]. 53 % des Gesamtgebietes stehen unter ackerbaulicher Nutzung. Ein knappes Viertel (24,3 %) der Fläche ist mit Wald, vor allem Laub- und Mischwäldern bedeckt. Das Grünland nimmt 9 % der Fläche ein, gefolgt von Siedlungen (4,7 %), Ruderal- und Verkehrsflächen (2 % bzw. 1,8 %). über ein Prozent der Fläche erreichen darüber hinaus noch Gebüsche und Kleingehölze sowie die Grünanlagen der Siedlungsbereiche. Alle übrigen in Tabelle A 3.1-1 genannten Typen belegen Anteile von unter einem Prozent.
Die Flächenverteilung in den einzelnen Naturräumen kann stark von der des Gesamtraumes abweichen. Das Dormhügelland, der Hasenwinkel, die Helmstedter Mulde sowie der Lehrer Wold sind durch überdurchschnittliche Ackeranteile gekennzeichnet, während der Elm und die Twülpstedter Lehmplatte durch einen erhöhten Waldanteil auffallen (58,3 % bzw. 50,3 %). Das Schuntertal lässt sich in erster Linie durch den relativ hohen Grünlandanteil (48,2 %) und damit korreliert, den unterdurchschnittlichen Anteil an Ackerflächen (22,1 %) charakterisieren.
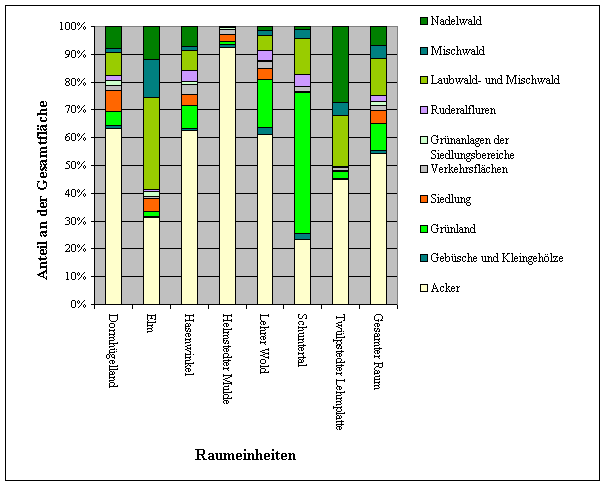
Wälder
Naturnahe Wälder frischer Standorte
Der überwiegende Teil der Wälder im Planungsgebiet stockt auf frischen Standorten. Diese buchendominierten, naturnahen Wälder sind oftmals „historisch alte Wälder“, d.h. die Standorte sind seit mehreren Jahrhunderten kontinuierlich mit Wald bedeckt. Diese Konstanz ist wertgebend für den Naturschutz, da sie die Voraussetzung für eine ununterbrochene Besiedlung einer Vielzahl hoch spezialisierter und wenig mobiler Arten ist. Diese Voraussetzungen erfüllt in besonderer Weise der Elm, der kontinuierlich Wald trägt, nachweislich seit dem Mittelalter. In den unteren Lagen waren dies vorrangig Eichenwälder, weil diese vielfältiger genutzt und daher in Siedlungsnähe gefördert wurden (Mast, kürzere Umtriebszeiten). In den höheren Lagen des Elms waren dagegen Buchenwälder dominant. Heute kommen die Buchenwälder im Elm, am Dorm und im Waldgebiet von Rottlof vor. Neben dem flächenmäßig weit verbreiteten Mesophilen Buchenwald kalkärmerer Standorte ist insbesondere der Typ des Mesophilen Kalkbuchenwaldes aus Naturschutzsichterwähnenswert, da dieser Biotoptyp von einer Vielzahl gefährdeter Arten (z.B. Seidelbast (Daphne mezereum) oder Türkenbundlilie (Lilium martagon)) besiedelt wird.
Neben den buchendominierten Wäldern kommen auch Mesophile Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder auf den mittleren Standorten vor. Ihre Entstehung sowie ihr Erhalt auf diesen Standorten ist jedoch eng mit dem menschlichen Einfluss verknüpft. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Hainbuche (v.a. ihre Schnittverträglichkeit) und der Eiche (Mast) haben zu einer Förderung und Ausweitung dieses Waldtyps über seinen eigentlichen natürlichen Standort hinaus gesorgt. Diese Ausweitung geschah i.d.R. auf Kosten der Buche. So ist zum Beispiel der Strukturreiche Eichen- und Hainbuchen-Mischwald als Ersatzgesellschaft von Mesophilen Kalkbuchenwäldern am Rieseberg die Folge der intensiven Nutzung des Waldes in den letzten Jahrhunderten. ähnliches gilt für den Strukturreichen Eichen- und Hainbuchen-Mischwald als Ersatzgesellschaft von ärmeren Ausprägungen Mesophiler Buchenwälder auf weniger kalkreichen Standorten am Elm und in den Wäldern um Bisdorf.
Im Plangebiet liegt der natürliche Standort der Hainbuchen- und Eichenwälder (die potenzielle natürliche Vegetation – pnV) in den (stau-) feuchten Gebieten und überschwemmungsbereichen der Schunterniederung und ihrer Nebengewässer. Die mesophilen Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder sind je nach Standort mit anderen Laubbaumarten gemischt. Auf den mesophilen Standorten treten v.a. die Buche, aber auch Ahorn, Linde und Esche hervor, auf den feuchten und nassen Standorten dagegen im größerem Umfang die Erle und die Esche. Der Mesophile Eichen- und Hainbuchen-Mischwald feuchter, basenärmerer Standorte findet man sowohl im Elm als auch im Sundern, in der Wohldrühme, im Mühlenhop und im Bisdorfer Holz. Der Mesophile Eichen- und Hainbuchen-Mischwald feuchter, basenreicher Standorte findet sich nur an wenigen Stellen im Planungsgebiet, vorrangig ist er im Südwesten des Riesebergs verbreitet, daneben gibt es einige kleinere Vorkommen in der Umgebung von Bisdorf.
Naturnahe Wälder feuchter und nasser Standorte
Von Erlen und Eschen beherrschte Feuchtwälder kommen im Planungsgebiet relativ häufig vor. In der Regel handelt es sich um schmale bachbegleitende Erlen-Eschenwälder der Auen- und Quellbereiche (WE) oder um kleinflächige Bestände innerhalb bestehender Waldgebiete. Der Erlen-Bruchwald (WA) ist ebenfalls meist kleinflächig verbreitet; er ist auf die Niederungsbereiche der Schunter und der Uhrau beschränkt. Hier tritt er in Form des Erlen-Bruchwaldes nährstoffreicher Standorte auf. Daneben existiert ein großflächiges Vorkommen des Erlen- und Birken-Erlenbruchwaldes nährstoffärmerer Standorte des Tieflandes im Rieseberger Moor. Dieser Lebensraum nimmt hier eine Fläche von über 45 ha ein, ist aber kleinflächig mit anderen, weniger dominanten Biotoptypen verzahnt. Innerhalb dieses nassen Milieus ist der Nährstoffgehalt des Bodens für die Ausprägung des Biotoptyps entscheidend. Während der Erlen-Bruchwald auf etwas reicheren Standorten zu finden ist, wird der kleinflächig eingenischte Birken-Bruchwald auf jene Bereiche zurückgedrängt, die nährstoffärmer sind. Die übergänge zwischen den Typen sind entlang des Gradienten (WAR-WAT-WBA) fließend. Das Rieseberger Moor ist aufgrund seines relativ „intakten Wasserhaushaltes“ (Cassel et al. 2000: 44, vgl. auch Kap. 3.3.4.1.) von besonderer Bedeutung für den Flächenschutz. Dieser manifestiert sich zum einen in der Ausweisung als NSG sowie als Gebiet, das nach FFH-Richtlinie (92/43/EWG) als Bestandteil des europäischen kohärenten Schutzgebietssystems „Natura 2000“ nach Brüssel gemeldet wurde.
Ein weiterer im Plangebiet nachgewiesener Wald der nassen Standorte ist der Erlen- und Eschen-Sumpfwald. Er ist im so genannten Klein Steimker Moor mit wenigen Flächen verbreitet. Neben den namensgebenden Arten treten in der Baumschicht Birken und Weiden auf. Dieser Typ ist, wie alle anderen aufgeführten Wälder der nassen Standorte, nach § 28a NNatG geschützt.
Wälder trockenwarmer Standorte
Die Wälder trockenwarmer Kalkstandorte sind im Plangebiet auf die Rendzinen am Dorm beschränkt. Dort kommt, vor allem an der südwest-exponierten Seite des Dorms, der Buchenwald trockenwarmer Kalkstandorte vor. Die Flachgründigkeit des Standortes und die Exposition verhindern eine geschlossene Baumschicht, so dass sich eine artenreiche Besiedlung der Krautschicht einstellen kann. Hier finden Arten einen Lebensraum, die licht- und wärmebedürftig sind (Zacharias 1986). Auf floristisch interessanten Saumgesellschaften, die sich diesen Wäldern anschließen, wird weiter unten eingegangen.
Ein kleiner Bestand eines thermophilen Eichen-Elsbeeren-Waldes befindet sich als Eichen-Mischwald trockenwarmer Kalkstandorte am nordwestlichen Rand des Rieseberges. Dieser Bestand ist ebenfalls floristisch interessant, da er eine Vielzahl gefährdeter Arten beherbergt. Kleinere Bestände dieses Typs sind dagegen nicht mehr als eigenständige Biotope abgegrenzt, sondern dem bereits besprochenen WCK zugeordnet worden (Cassel et al. 2000). Auch hier, auf diesen trockenwarmen Standorten, ist der Eichen-Mischwald wieder die Ersatzgesellschaft des zuvor genannten Buchenwaldes.
Neben den kalkreichen Standorten gibt es weitere naturschutzfachlich interessante trockenwarme Wälder auf Sandstandorten. Der Eichen-Mischwald armer, trockener Sandböden stockt im Hasenwinkel auf Podsolen. Neben den Eichen kommen Birken, Kiefern und Buchen in diesem Biotoptyp vor.
Gebüsche und Kleingehölze
Gebüsche, Hecken und Feldgehölze sind neben Baumgruppen,
Baumreihen und Einzelbäumen und
-sträuchern zentrale Elemente einer gegliederten
Kulturlandschaft. In den letzten Jahrzehnten haben gerade die
intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaften einen großen
Teil ihrer Gehölzbestände eingebüßt. Auch der Ausbau der BAB
hat den Verlust einer Vielzahl von Strukturelementen mit sich
gebracht.
Im Planungsgebiet sind die vorwiegend beackerten Landschaften relativ arm an Gehölzen, v.a. im südöstlichen Teil. Andererseits haben sich an einigen Stellen Hecken- und Gebüsche dort erhalten können, wo das Gelände kleinflächig gegliedert ist oder an Grundstücksgrenzen.
Neue Gehölzbestände sind stellenweise durch Neuanlage in strukturarmen Ackergebieten entstanden, wo sie aufgrund von Initiativen Einzelner oder von Vereinen im Rahmen des Anpflanzungsprogramms des Landkreises Helmstedt angelegt wurden. Im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für die Erweiterung der BAB 2 wurden (vor allem im nordwestlichen Bereich des Plangebietes und entlang der Autobahn) eine Reihe von Flächen bepflanzt.
Bei den Gebüschen feuchter und nasser Standorte ist in erster Linie das Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte hervorzuheben. Es konzentriert sich auf die feuchten Niederungsbereiche der Schunter (z.B. im NSG Lutterlandbruch) und ist auch im Rieseberger Moor vertreten. Die Gebüsche trockenwarmer Standorte sind u.a. durch die Laubgebüsche trockenwarmer Kalkstandorte vertreten. Sie haben im Planungsgebiet zwei Vorkommen am Dorm bzw. Rieseberg. Diese Laubgebüsche bilden die Gehölzmäntel der Buchenwälder und Eichen-Mischwälder (WTB bzw. WTE) auf trockenwarmen Kalkstandorten. Sie sind durch eine Reihe wärmeliebender Gehölzarten gekennzeichnet, zu denen im Gebiet Rosa micrantha, Rhamnus cartharticus und Cornus sanguinea zählt (Zacharias 1986: 53). Als Schnittstelle zwischen Offenland (wärmeliebende Staudensäume) und Wald findet man Arten beider Seiten in diesen Gebüschen.
Gewässer
Quellen
In Niedersachsen sind alle naturnahen Quellen gesetzlich geschützt (§ 28a NNatG). Im Einzelnen sind dies Tümpel-, Sturz-, und Sicker- oder Rieselquellen.
Die Tümpelquellen ergießen sich in ein darüber liegendes Gewässer und sind daher nicht immer kartierbar, vor allem dann nicht, wenn das Gewässer weitere Zuflüsse hat. Vermutlich gibt es daher neben den 5 bekannten Quellen diesen Typs noch weitere. Der Landschaftsrahmenplan macht darauf aufmerksam, dass die meisten Tümpelquellen im Gebiet ursprünglich eher den Charakter einer Sickerquelle hatten, bevor die Quellbereiche künstlich zu Quellteichen umgebaut wurden (Cassel et al. 2000). Die einzige natürliche Tümpelquelle im Plangebietgebiet ist demnach die Lutterquelle (ebd.). Die selten anzutreffende Sturzquelle – imPlangebiet sind vier bekannt – ist die auffälligste der drei Quelltypen. Hier fließt das Wasser unmittelbar als Bach ab. Drei dieser Quellen fließen in die Schickelsheimer Riede, die vierte befindet sich an der Lutterquelle und speist die Lutter. Die Sicker- oder Rieselquellen sind die häufigsten Quellen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass an Hängen, Mulden und in Niederungen flächig Wasser zutage tritt. Diese meist sumpfigen oder moorigen Standorte werden im Wald von Erlen-Eschen-Quellwäldern und Quellsümpfen besiedelt.
Die Lutterquelle ist mit Abstand die bekannteste Quelle im Planungsgebiet und fördert täglich durchschnittlich 20.000 m³ Wasser. Sie zählt damit zu einer der ergiebigsten Quellen Norddeutschlands. Sie liegt im Grenzbereich einer Mergelschicht, die den Elm nach unten hin „abdichtet“. Das Wasser in diesem unterirdischen Becken steigt bis auf die Höhe der Lutterquellen und tritt hier zutage („überlaufquelle“). Alle drei beschriebenen Quelltypen kommen im Bereich der Lutterquellen vor.
Fließgewässer
Alle Fließgewässer im Planungsgebiet sind dem Wassereinzugsgebiet der Schunter zuzuordnen. Die Schunter ihrerseits entwässert über Oker und Aller in die Weser. Typisch für das Plangebiet sind Fließgewässer des Berg- und Hügellandes, teilweise auch Gewässer der Niederungen. Naturschutzfachlich von besonderem Wert sind die naturnahen Abschnitte der Fließgewässer, von denen zwei Typen zu nennen sind. Zum einen der Naturnahe sommerkalte Bach des Berg- und Hügellandes. Dieser Typ ist, abgesehen von seiner Naturnähe, d.h. vielgestaltigen Morphologie, Durchgängigkeit und Vegetation durch eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit gekennzeichnet. Es handelt sich häufig um Bachoberläufe, die zum Teil in Wäldern verlaufen. Im Planungsgebiet befinden sich fünf Gewässerabschnitte, die diesem Typ zuzuordnen sind. Der längste Abschnitt ist der Oberlauf des Schierpkebaches, der von Langeleben bis an den Waldrand des Elms verläuft. Ein weiterer Abschnitt dieses Typs liegt nördlich davon, es handelt sich um den Oberlauf des Schambachs. Auch hier ist nur der im Wald verlaufende Abschnitt noch naturnah. Mit dem Eintritt in die agrarisch genutzte Landschaft ist der Zustand der Gewässer schlagartig naturfern. Zwei weitere kurze Abschnitte liegen im Naturraum Börde, einer davon ist der Oberlauf der Schickelsheimer Riede, auch als Scheidewellenbach bekannt.
Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen, eher schnell fließenden Gewässerabschnitten ist der Naturnahe sommerwarme Niederungsbach durch eine herabgesetzte Fließgeschwindigkeit und daher durch ein eher schlammiges und sandiges Sediment gekennzeichnet. Die Vegetation kann innerhalb des Gewässers bei ausreichender Besonnung üppig sein (Röhrichte, Laichkrautgesellschaften etc.), die Ufer entlang des Gewässers sind in der Regel mit Bruchwald, Röhrichten, Hochstaudenfluren oder Grosseggenrieder bewachsen. Der einzige Gewässerabschnitts dieses Typs ist das Teilstück der Lauinger Mühlenriede, das am Naturschutzgebiet Rieseberger Moor entlang führt.
Stillgewässer
Der größte Teil der Stillgewässer im Plangebiet ist künstlich angelegt worden oder im Zuge des Bodenabbaus entstanden. Bei den meisten Gewässern handelt es sich um Kleingewässer mit einer Größe von unter einem Hektar (fast 95 %). Lediglich bei elf der in der Biotoptypenkarte erfassten 222 Stillgewässer handelt es sich um größere Stillgewässer. Diese sind fast ausnahmslos durch Rohstoffabbau entstanden. Nördlich der BAB 2, im Bereich von Uhry, sind z.Zt. noch zwei Unternehmen mit dem Abbau von Quarzsand beschäftigt. Dieser Abbau geschieht sowohl als Trocken- als auch als Nassabbau.
Stillgewässer natürlichen Ursprungs sind im Plangebiet sehr selten. Nur in zwei Fällen ist diese natürliche Entstehung belegt. Im einen Fall handelt es sich um den zwischen Bornum und Königslutter gelegen, bekanntesten und größten Erdfall des Plangebietes. Er ist als Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer natürlicher Entstehung kartiert worden, da er dauerhaft mit Wasser gefüllt ist. Andere Erdfälle sind dagegen deutlich kleiner und führen oftmals nur temporär im Frühjahr Wasser.
Das zweite Beispiel eines Gewässers natürlicher Entstehung ist das einzige Altgewässer im Planungsgebiet, es liegt östlich der Ortschaft Glentorf in der Schunterniederung und wurde als Kleines naturnahes Altwasser kartiert. Bei diesem Lebensraum handelt es sich um eine alte Schunterschleife.
Auch die Gewässer anthropogenen Ursprungs können für den Naturschutz von Bedeutung sein, wenn sie sich in einen naturnahen Zustand befinden. Von den Stillgewässern können nur ca. 50 als naturnah bezeichnet werden. Zu nennen sind die Naturnahen nährstoffreichen Abbaugewässer und die Naturnahen nährstoffreichen Stauteiche. Die weiteste Verbreitung (mit 44 Exemplaren) hat jedoch der Typ des Sonstigen naturnahen nährstoffreichen Kleingewässers. In diesem Typ werden Gewässer zusammengefasst, die jagdlichen Zwecken dienen, aus Gründen des Naturschutzes angelegt wurden oder deren sonstige Nutzung eingestellt wurde (z.B. ehemalige Fischteiche). Das Rieseberger Moor bietet einige naturnahe nährstoffarme Torfstichgewässer. Diese Gewässertypen stammen noch aus jener Zeit, in der im Rieseberger Moor Torf gestochen wurde (bis nach dem 2. Weltkrieg, vorrangig aber bis Mitte des 19. Jahrhunderts). Inzwischen haben sie sich größtenteils regeneriert und eine Verlandungszone ausgebildet (Rieger 1979).
Gehölzfreie Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer
Seggen-, Binsen-, und Stauden-Sumpf ist mit fünf unterschiedlichen Biotoptypen und einer Gesamtfläche von ca. 28 ha im Planungsgebiet vertreten. Die Vorkommen sind von nassen bis sehr nassen Standorten außerhalb der Gewässer abhängig. Diese Voraussetzungen können auf Niedermoor oder grundwasserfeuchten Mineralböden erfüllt sein. Entsprechend können die größten Flächenanteile im Rieseberger Moor, in der Glentorfer Moorniederung und im Lutterlandbruch festgestellt werden. Eine weitere Bedingung für die Entwicklung von Sümpfen ist die Nutzungsaufgabe bzw. die sehr extensive Nutzung der Bestände.
Der Basen- und nährstoffarme Sumpf ist auf das Rieseberger Moor beschränkt, da nur hier noch die erforderliche Nährstoffarmut herrscht. Nicht nur im Plangebiet, auch im Landkreis Helmstedt sind nährstoffarme Sümpfe selten (Cassel et al. 2000). Die Glentorfer Moorniederung und der Lutterlandbruch sind durch erhöhte Nährstoffgehalte gekennzeichnet und weisen daher andere – im Plangebiet weiter verbreitete – Formen der Sümpfe auf. Die Typisierung der Bestände erfolgt anhand der dominanten Pflanzenarten: neben dem Seggenried , kommt das Binsen- und Simsenried und der Staudensumpf nährstoffreicher Standorte vor, zusätzlich der Sonstige nährstoffreiche Sumpf . Von den genannten Typen ist das Seggenried nährstoffreicher Standorte mit insgesamt knapp 14 ha (mit Schwerpunkt Glentorfer Moorniederung) am häufigsten vertreten.
Die zweite Gruppe der gehölzfreien Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer sind die Landröhrichte. Ihre Standorte sind – im Vergleich zu den Sümpfen – durch eine etwas geringere Bodenfeuchte gekennzeichnet. Darüber hinaus weist die Vegetation die typische höhere Röhrichtstruktur auf. Auch das Vorkommen der Landröhrichte ist auf die Niederungen beschränkt (Glentorfer Moorniederung, Scheppauniederung, Schunterniederung, Lutterlandbruch). Wie bei den Sümpfen werden auch hier zur Unterscheidung der Biotoptypen die dominanten Arten herangezogen. Vier Typen sind vertreten; sie bedecken eine Fläche von ca. 29 ha. Den größten Anteil nimmt das Schilf-Landröhricht mit knapp 21 ha ein, gefolgt vom Rohrglanzgras-Landröhricht, Rohrkolben-Landröhricht und Wasserschwaden-Landröhricht. Alle genannten Biotoptypen sind nach § 28a des NNatG geschützt.
Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope
Diese Obereinheit ist in Königslutter nur durch einen Biotoptyp vertreten, den Natürlichen Erdfall im Gipskarst. Es handelt sich um eine interessante geomorphologische Erscheinungsform des sog. Gipskarst und entsteht durch allmähliche Auslaugung von lösungsfähigem Anhydrit im Untergrund und dem nachfolgenden allmählichen oder abrupten Nachsacken der Erdoberfläche. Die Folge ist eine im Ideal kreisrunde, schüsselförmige Vertiefung. Erdfälle können in Abhängigkeit von der Untergrundbeschaffenheit mit Grund- oder Regenwasser gefüllt sein. Im Gebiet führt allerdings nur der für seine typische Form bekannte Erdfall zwischen Bornum und Königslutter dauerhaft Wasser. Die übrigen, kleineren Erdfälle im Elm und im Dorm führen dagegen nur vorübergehend Wasser. Während die Erdfälle im Elm vereinzelt auftreten, gibt es am Dorm eine Erdfalllinie, die durch eine Reihe von perlschnurartig (in nordwestlich nach südöstlich verlaufender Richtung) aufgereihten Erdfälle gekennzeichnet ist. Die Erdfälle sind z.T. „als vegetationslose, meist nährstoffarme Tümpel ausgebildet“, die „mit periodisch trockenfallenden Erlenbruchwäldern bestanden sind“ (Cassel et al. 2000: 68).
Heiden und Magerrasen
Heiden sind lediglich durch den Biotoptyp der Trockenen Sandheide vertreten. Die zwei Flächen dieses Typs im Plangebiet werden im wesentlichen durch die Besenheide aufgebaut, die hier, im südlichen Teil des Rieseberger Moores, auf einem trockenen Sandhügel wächst. Die trockene Sandheide nimmt eine Fläche von weniger als 2 ha ein. Weitere Flächen dieses Typs existieren im Planungsraum nicht. Selbst im Landkreis Helmstedt existiert lediglich eine weitere Fläche.
Magerrasen sind im Planungsgebiet auf ca. 10 ha mit über 15 Flächen vertreten. Mit einer Durchschnittgröße von 0,6 ha sind die Biotope überwiegend klein. Neben den Kalk-Magerrasen, die in allen drei Entwicklungsstufen vom Kalkmagerrasen-Pionierstadium über den Typischen Kalk-Magerrasen bis hin zum Saumartigen Kalk-Magerrasen im Elm vorkommen, sind die verschiedenen Sand-Magerrasen zu nennen. Sie beschränken sich auf Vorkommen in den Naturräumlichen Einheiten des Hasenwinkels (624.21) und des Dormhügellandes (512.20). Innerhalb dieser oft lückigen und niedrigwüchsigen Vegetationseinheiten lassen sich drei Biotoptypen differenzieren: die meist artenarme Silbergras-Flur, der Basenreiche Sand-Magerrasen sowie der am häufigsten vorgefundene Sonstige Sand-Magerrasen. Die Sand-Magerrasen sind weitgehend nutzungsbedingte Biotope, die ihre Entstehung früher vorrangig der extensiven Beweidung und heute vor allem dem langjährigen Brachfallen von Sandäckern verdanken.